Exkursionen des Entsorgungsbeirates Um Einblicke in die Endlagertätigkeiten von anderen Staaten zu bekommen, führt der Entsorgungsbeirat Exkursionen durch. Dabei werden Endlagerprojekte anderer Staaten angeschaut und Gespräche mit den Behörden und lokalen Vertretern vor Ort geführt.
Durchgeführte Exkursionen bisher:
Österreichischer Entsorgungsbeirat in der Schweiz

Eine Delegation des Entsorgungsbeirates besuchte vom 16. bis 17. Oktober 2023 das Nachbarland Schweiz mit dem Ziel, Einblicke in das Schweizer Standortauswahlverfahren, die dazugehörigen Beteiligungsformate und das Felslabor Mont Terri zu gewinnen. Die Schweiz plant, schwach- und mittelradioaktive Abfälle gemeinsam mit hochradioaktiven Abfällen und abgebrannten Brennelementen in einem geologischen Tiefenlager zu entsorgen.
Der Besuch in der Schweiz zeigte dem Entsorgungsbeirat, dass ehrliche Kommunikation von großer Bedeutung ist - sowohl bei der Information über Misserfolge als auch über Erfolge. Es ist ebenso wichtig, die Sicherheit und Vorteile eines Endlagers zu betonen. Der Besuch im Forschungsstollen verdeutlichte die Bedeutung der Forschung zur Klärung offener Fragen.
Der Aufenthalt in der Schweiz begann in der Gemeinde Stadel, dem Ort, an dem der Eingang zum Endlager geplant ist. Dort fanden Treffen und Gespräche mit Vertreter:innen der Behörden, Betreiber:innen, lokalen Politiker:innen, Regionalkonferenzen und NGOs statt. Dieser Austausch ermöglichte einen Einblick in das Schweizer Verfahren, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Herausforderungen, die ein derart großes Projekt begleiten. Das Schweizer Konzept strebt eine aktive und breite Öffentlichkeitsbeteiligung an.

NAGRA
Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ist ein technisch-wissenschaftliches Kompetenzzentrum für die Entsorgung radioaktiver Abfälle in geologischen Tiefenlagern. Sie ist für die Entsorgung und Endlagerung von radioaktiven Abfällen in der Schweiz zuständig und wird später auch das Endlager errichten. Das Unternehmen wurde 1972 von den Abfallproduzenten, den Kernkraftwerksbetreibern und der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund) gegründet. Diese finanzieren die laufenden Kosten der Nagra gemäß dem Verursacherprinzip.
Das kombinierte geologische Tiefenlager
Bis 2019 waren in der Schweiz fünf Reaktoren zur Stromproduktion in Betrieb. Heute sind es noch vier Reaktoren, denn Ende 2019 wurde der Reaktor in Mühleberg nach 48-jährigem Betrieb abgeschaltet. Alle radioaktiven Abfälle der Schweiz, eingeteilt in schwach- und mittelaktiven Abfall (SMA) sowie hochaktiven Abfall (HAA), werden bei den Kernkraftwerken oder im Zentralen Zwischenlager (Zwilag) gesammelt. Die Nagra sieht ein kombiniertes geologischen Tiefenlager für diese Abfälle in einer Tiefe von bis zu 1000 Metern vor.
Schweizer Standortauswahlverfahren
Im Jahr 2008 wurde der Sachplan geologische Tiefenlagerung (SGT) beschlossen. Dieser Plan regelt die Standortsuche und sieht ein geologisches Tiefenlager für schwach-, mittel- und hochradioaktive Abfälle sowie abgebrannte Brennelemente vor. Die Standortauswahl findet im Rahmen des Sachplans geologische Tiefenlager in drei Etappen statt und definiert Sicherheit als oberste Priorität. Die Nagra hat im September 2022 Nördlich Lägern als Standort vorgeschlagen.
Beteiligung
Der Sachplan regelt auch die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Standortsuche. Diese wird in verschiedenen Formaten organisiert.
Der Beirat Entsorgung berät das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) bei der Durchführung des Auswahlverfahrens, hat jedoch keine Entscheidungskompetenz. Der Beirat setzt sich aus Wissenschaftler:innen, Vertreter:innen des Nationalrats, der Industrie und der Presse zusammen.
Zusätzlich gibt es Regionalkonferenzen, an denen sich die lokale Bevölkerung der möglichen bzw. vorgeschlagenen Standorte beteiligen kann. Ziele der Regionalkonferenzen sind es, die Anliegen, Fragen und Bedürfnisse der Region festzustellen. Außerdem können die Regionalkonferenzen bei der Gestaltung der Oberflächeninfrastruktur mitwirken und Einfluss auf sozioökonomischen Studien nehmen. Allerdings gibt es keine Mitbestimmung und keine Mitsprache bei Grundsatzfragen wie etwa beim Standort des Tiefenlagers oder bei Fragen der Sicherheit.
Die betroffenen Gemeinden binden die Bürger:innen durch Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen auch aktiv ein. Den Gemeinden sind eine gute Kommunikation, der Zugang zu transparenter Information sowie ein faires Abgeltungsverfahren wichtig.
Besuch im Forschungslabor Mont Terri
Am zweiten Tag der Exkursion besuchte der Entsorgungsbeirat das Felslabor Mont Terri, in dem die Eigenschaften des Opalinustons untersucht werden.
Der Forschungsstollen Mont Terri entstand zufällig beim Bau eines Autobahntunnels, als man eine Schicht Opalinuston entdeckte. Durch die daraufhin durchgeführten Untersuchungen zeigte sich, dass Opalinuston nahezu wasserundurchlässig ist. Opalinuston erwies sich als sehr gut geeignetes Wirtsgestein für die Endlagerung radioaktiver Abfälle zu sein. Aus diesem Grund wurde der Forschungsstollen erweitert, um die Eigenschaften dieser Gesteinsart und Methoden für Endlagerung radioaktiver Abfälle genau zu erforschen. Heute ist das Felslabor Mont Terri ein internationales Forschungsprojekt mit insgesamt über 170 Experimenten. Neuere Experimente befassen sich auch mit der Möglichkeit der CO2 Lagerung.


Österreichischer Entsorgungsbeirat in Belgien

Im Sommer 2023 besuchte eine Delegation des österreichischen Entsorgungsbeirates Belgien, um einen Einblick in das geplante belgische Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu erhalten und das einzigartige Partizipationsmodell kennenzulernen, das bei der Standortauswahl eingesetzt wurde. Außerdem wurde das Untergrundforschungslabor HADES besichtigt, in dem Experimente durchgeführt werden, die für die Errichtung des geologischen Tiefenlagers notwendig sind (z. B. zur Tiefenmigration der Radionuklide im Tongestein).
Die Vertreter:innen des österreichischen Entsorgungsbeirats konnten bei dieser Exkursion wichtige Erkenntnisse gewinnen, die für die weitere Arbeit des Entsorgungsbeirates sehr wertvoll sind. Vor allem der Austausch mit den lokalen Partnerschaften der Gemeinden Mol und Dessel sowie der Projektleitung ONDRAF/NIRAS hat gezeigt, dass eine aktive Einbindung der lokalen Bevölkerung maßgeblich zum Projekterfolg beiträgt.
ONDRAF/NIRAS
ONDRAF/NIRAS (französisch: Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, niederländisch: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte Splijtstoffen) ist die nationale belgische Einrichtung für radioaktive Abfälle und angereicherte Spaltmaterialien. Sie ist seit 1980 für die Entsorgung radioaktiver Abfälle in Belgien zuständig.
Bereits in den 1970er-Jahren wurden die ersten Kernkraftwerke (KKW) in Belgien in Betrieb genommen, der damals geplante Betriebszeitraum betrug 40 Jahre. Im Jahr 2023 waren insgesamt 5 Reaktorblöcke an den beiden Standorten Mol und Tihange in Betrieb.
Geplantes Endlager in Dessel
Die Bewilligung für das zukünftige oberflächennahe Endlager für kurzlebige schwach- und mittelradioaktive Abfälle am Standort Dessel erfolgte im Mai 2023. ONDRAF/NIRAS ist für die Projektleitung einschließlich der Partizipation zuständig. Der Standort wurde bereits zuvor als medizinische Einrichtung (inkl. Zyklotron, heiße Zellen etc.) genutzt und wurde vollständig dekommissioniert (stillgelegt). Der Baubeginn ist für 2024 geplant, und 2027 soll mit der Einlagerung (max. 70.000 m³) begonnen werden.
Fünfzig Jahre nach der Inbetriebnahme ist der Verschluss des Endlagers geplant. Dann soll eine biologische Schutzschicht über das Endlager gelegt und begrünt werden. Für die Nachbetriebsüberwachung ist ein Zeitraum von 350 Jahren festgelegt.
Standortauswahl und Beteiligung
Die Standortsuche für ein Endlager war vor allem eine soziale Herausforderung. Nach verschiedenen erfolglosen Versuchen wurde nach freiwilligen Gemeinden gesucht. Die drei Gemeinden Mol, Dessel und Fleures-Farciennes, die bereits nukleare Einrichtungen in der Umgebung haben, erklärten sich bereit sogenannte Partnerschaften (MONA, STOLA, Paloff) mit Vetorecht zu bilden.
Zum Gelingen der Partnerschaft trug vor allem die offene und ehrliche Kommunikation mit der Bevölkerung zum Beispiel über Gemeindezeitungen oder soziale Medien bei. Außerdem hatten die Gemeinden ein aktives Mitspracherecht bei der Gestaltung des Endlagers, sodass auch von ihnen gewünschte Anforderungen umgesetzt wurden.
Die Partnerschaften trafen sich monatlich, um konkrete Pläne zum Endlager und Benefits auszuarbeiten, dabei stand stets der Sicherheitsgedanke im Vordergrund. Den Zuschlag erhielt schließlich Dessel, wo das Endlager errichtet werden soll. Aber auch danach wurde die Partnerschaft mit der benachbarten Gemeinde Mol weitergeführt.
Die Partizipation soll auch nach der Bewilligung des Endlagers fortgesetzt werden, um neue Projekte gemeinsam mit der Bevölkerung zu entwickeln. Auch der Prozess der Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle soll von den Partnerschaften partizipativ begleitet werden.
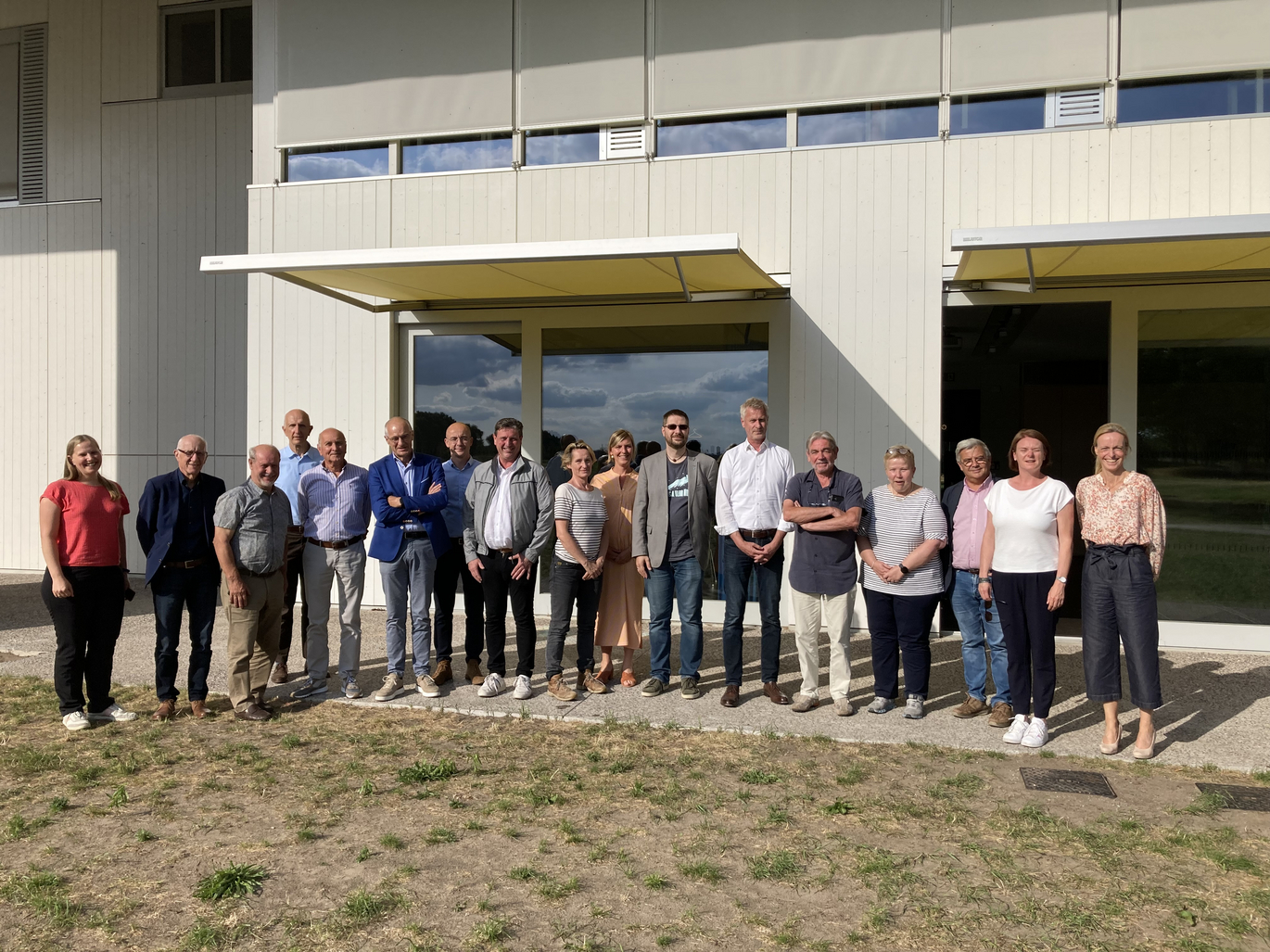
Besucherzentrum Tabloo
Die Errichtung des Besucherzentrums Tabloo war eine der sozialen Bedingungen, die die Partnerschaften für den Bau des Endlagers stellten. Tabloo befindet sich etwas außerhalb von Dessel und hat die Form eines riesigen Tisches. Die Grundidee dieser Architektur ist zu veranschaulichen, dass das Projekt entstanden ist, indem sich die verschiedenen Parteien gemeinsam an einen Tisch gesetzt und das Problem gemeinsam gelöst haben. Selbst wenn alle Holzbestandteile des Gebäudes in 300 Jahren verfallen sind, wird der Betontisch weiterhin an die radioaktiven Abfälle vor Ort erinnern. Alle Pläne und Umsetzungsmöglichkeiten für Tabloo wurden partizipativ von der lokalen Bevölkerung gestaltet.
Das Besucherzentrum dient als Kommunikationszentrum für die Nachbarschaft und besteht aus mehreren Teilen: Seminarräume für die Gemeinden, Veranstaltungsräume, Theater, Bistro, eine Ausstellung zum Thema Radioaktivität und radioaktive Abfälle, ein Lehrpfad, eine Aussichtsterrasse sowie Laborräume für Schulen. Der Grundgedanke ist, dass Tabloo sich selbst finanziert.

EURIDICE & HADES
EURIDICE (European Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in Clay Environment) ist eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen ONDRAF/NIRAS und SCK CEN (Belgisches Studienzentrum für Kernenergie).
EURIDICE betreibt das Untergrundlabor HADES (High Activity Disposal Experimental Site). Dort entwickeln und erproben Expert:innen industrielle Technologien für den Bau, den Betrieb und die Schließung einer Tontiefenlageranlage. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen Experimente unter „realen“ Bedingungen in der tiefen Tonschicht, in großem Maßstab und über lange Zeiträume durch, um die Sicherheit und Machbarkeit der geologischen Endlagerung in niedrig gehärtetem Ton zu bewerten. Das erste europäische Untergrundlabor wurde in den 1980er-Jahren per Hand errichtet und liegt in einer Tiefe von 225 m. Zu Beginn der 2000er-Jahre wurde das Labor erweitert, wobei industrielle Techniken eingesetzt wurden, auch um zu untersuchen, ob und wie man mit diesen Methoden ein Endlager bauen kann.

Der Besuch in Belgien war für die Arbeit des Entsorgungsbeirates sehr wertvoll. Der Einblick in die praktische Umsetzung der Endlagerproblematik in anderen Staaten lieferte wichtige Erkenntnisse für die Empfehlungen des Entsorgungsbeirates.
Österreichischer Entsorgungsbeirat für Recherche in Frankreich
Anfang September 2022 reiste eine Delegation des Entsorgungsbeirates nach Troyes in Frankreich, um sich mit der französischen Behörde auszutauschen sowie Einblicke in das französische Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle (LLW: low level waste) und das Endlager für sehr schwach radioaktive Abfälle (VLLW: very low level waste) zu erhalten. Auch Gespräche mit Vertreter:innen der lokalen Bürgervertretung standen auf dem Programm.
Die französische Betreibergesellschaft für die Konditionierung (so nennt man die Aufbereitung und Verpackung radioaktiver Abfälle) und die Lagerung radioaktiver Abfälle ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs) gab einen ersten Überblick über die verschiedenen Endlager, die Rechtsgrundlagen sowie die Beteiligung der lokalen Bevölkerung. Anschließend gab es Führungen durch die beiden Endlager CIRES und CSA.

CIRES – Endlager für sehr schwach radioaktiven Abfall
Die Anlage ist seit 2003 in Betrieb und für 650.000 m³ radioaktiven Abfall (VLLW) bewilligt. Hier wird der Abfall in 8,5 m tiefen und 100 m langen Gräben gelagert. Diese werden mit Abfall befüllt, bis sie 6 m über Grund reichen. Die Gräben sind in einer Tonschicht gebaut (passive Barriere) und mit einer wasserdichten Geomembran abgedichtet (aktive Barriere). Sobald sie gefüllt sind, werden sie auch an der Oberfläche mit einer Geomembran abgedichtet und das Lager wird renaturiert.
CSA – Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle mit kurzen Halbwertszeiten (LILW-SL)
Hier werden LILW-SL-Abfälle aus Forschung, Medizin, Universitäten und aus Dekommissionierungsprojekten (Stilllegung) behandelt und endgelagert. Das Lager hat eine Kapazität von 1.000.000 m³ und ist derzeit zu 35,3 % gefüllt. Der Abfall wird in Fässern konditioniert (1. Barriere), die anschließend in Betonquader von rund 25 m x 25 m x 25 m gestellt werden. Die Zwischenräume werden mit Beton verfüllt (2. Barriere). Sobald die Quader gefüllt sind, werden sie mit Erde aufgeschüttet (3. Barriere).
CLI (Commissions locales d’information) – lokale Informationskommission
Die CLI hat den Auftrag, die Öffentlichkeit über die Sicherheit zu informieren sowie die Auswirkungen der Aktivitäten der Anlage auf Mensch und Umwelt zu überwachen. In Frankreich ist in jedem Bezirk eine CLI eingerichtet. Sie ist der Ansprechpartnerin der Bevölkerung zu Umweltfragen und darf eigenständig Studien und Gutachten vergeben. Die unabhängige Organisation bekommt von der ANDRA alle Informationen zum Thema radioaktiver Abfall. Diese werden von der CLI für die Öffentlichkeit aufbereitet, sodass sie für die Allgemeinheit gut verständlich sind. In Gesprächen erfuhr die Delegation des Entsorgungsbeirates, dass es in den Regionen der Endlager in der Bevölkerung kaum Ablehnung gibt.
Der Entsorgungsbeirat konnte viele neue Erkenntnisse gewinnen und wertvollen Input für seine Arbeit mitnehmen, etwa zur Bedeutung einer verständlichen Kommunikation mit der Öffentlichkeit und eine gut durchdachte Öffentlichkeitsbeteiligung. Interessant war außerdem das Konzept der lokalen CLIs. Diese sind weder klassische NGO, noch staatliche Organe, aber als Begleitung und Form der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen.
Verglichen mit der Menge des französischen Abfalls ist die Menge des österreichischen Abfalls sehr gering. Der gesamte österreichische Abfall würde in einen Graben bzw. in einen der Betonquader passen.
Österreichischer Entsorgungsbeirat besucht geplantes Endlager für radioaktive Abfälle in Deutschland

In Salzgitter entsteht Deutschlands erstes nach deutschem Atomrecht genehmigtes Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Bei der Schachtanlage Konrad handelt es sich um ein ehemaliges Eisenerzbergwerk, das unter der Leitung der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) zum Endlager umgebaut wird. Ab 2027 sollen hier etwa 303.000 m3 schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus Kernkraftwerken und Betrieben der kerntechnischen Industrie eingelagert werden. Zum Vergleich: In Österreich werden bis 2045 rund 3.660 m3 schwach- und mittelradioaktive Abfälle zur Entsorgung anfallen.
Zahlen, Daten, Fakten zum Schacht Konrad
Wie viele Menschen braucht es, um ein Endlager für radioaktive Abfälle zu bauen, und wie viel kostet das Vorhaben? Im Schacht Konrad sind 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie bis zu 300 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigt. Bis 2027 fallen 4,2 Mrd. Euro an Kosten für die Errichtung des Schachts Konrad an. Danach werden jährliche Kosten von rund 80 Mio. Euro erwartet.
Entsorgungsbereit in den Tiefen des Schachts Konrad
Für die Delegation des Entsorgungsbeirates begann die Besichtigung mit einer Fahrt ins Erdinnere. In Schutzanzügen erkundeten die Mitglieder den bis zu 1.200 m tiefen Schacht. Die Temperaturen im Schacht steigen auf bis zu 30 Grad. Die Schachtanlage misst eine Länge von ca. 30 km und erstreckt sich über mehrere Sohlen (die Sohlen eines Bergwerks können als einzelne Stockwerke bezeichnet werden). Derzeit werden die Sohlen 1, 2 und 3 der Schachtanlage zu einem Endlager umgebaut. Die Arbeiter:innen errichten dazu die Transportstrecken und Einlagerungsfelder für die fertig konditionierten Abfallgebinde. Die Einfüllstollen, durch die die Abfälle in den Schacht eingebracht werden, werden eigens aufgefahren.

Im Anschluss an die Besichtigung des Schachts kam es zum Austausch zwischen der Delegation des Entsorgungsbeirates, dem Geschäftsführer der BGE, Stefan Studt, dem Projektleiter von Konrad, Peter Duwe , und Johannes Schneider von der Infostelle KONRAD. Besprochen wurden unter anderem die Herausforderungen beim Bau eines Endlagers und die Geschichte der Genehmigung für die Errichtung: Im Jahr 2002 wurde das Vorhaben mittels Planfeststellungsbeschluss genehmigt. 2007 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Genehmigung, und der Bau konnte beginnen. Der Schacht Konrad soll 2027 in Betrieb gehen. Nach dem Ende des Betriebs werden die Hohlräume des Schachts verschlossen. Weder die Rückholbarkeit noch die Bergbarkeit der radioaktiven Abfälle ist vorgesehen.

Die österreichische Delegation besuchte außerdem die „Informationsstelle Konrad“ in Salzgitter. Dort erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion Informationen über das Endlager sowie über die Öffentlichkeitsarbeit der BGE.
Den Abschluss des ersten Exkursionstages bildete ein Treffen mit der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad. Dabei handelt es sich um eine regionale Initiative, die sich kritisch mit den Endlagern für radioaktive Abfälle in der Region auseinandersetzt – neben der Schachtanlage Konrad auch mit dem Endlager Morsleben und der Schachtanlage Asse.

Wie kann die Kommunikation mit der Öffentlichkeit gelingen, und wie kann die Bevölkerung an den verschiedenen Endlagerverfahren beteiligt werden? Darüber diskutierten die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer mit Dagmar Dehmer, Leiterin der Unternehmenskommunikation des BGE.
Die Mitglieder des Entsorgungsbeirates blicken auf zwei spannende Tage zurück. Die Exkursion brachte frisches Wissen über die Entsorgung radioaktiver Abfälle und neue Impulse für die Arbeit des Beirates.
„Die Exkursion nach Salzgitter war unglaublich informativ! Die Perspektiven der unterschiedlichen Akteure und Akteurinnen haben mir geholfen, mein Verständnis für die notwendigen Prozesse zu erweitern. Die Befahrung des Schachts war ein absolutes Abenteuer und ein Eintauchen in eine mir bis dahin unbekannte Welt“, so Silvia Benda-Kahri, Vorsitzende des Entsorgungsbeirates, über die Exkursion.
